Schön, dass Sie da sind
bei WG-Gesucht.de!
bei WG-Gesucht.de!
Bonitätsnachweis auswählen
Bitte wähle einen Anbieter für deinen Bonitätsnachweis.
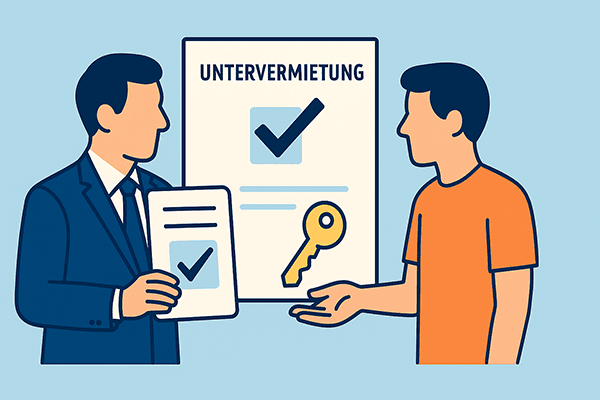 Wer Teile seiner Wohnung weitervermieten möchte, braucht meist die Zustimmung des Vermieters – Ausnahmen gelten nur für enge Angehörige.
Wer Teile seiner Wohnung weitervermieten möchte, braucht meist die Zustimmung des Vermieters – Ausnahmen gelten nur für enge Angehörige.
Eine Untervermietung liegt vor, wenn der Mieter einen Teil der Wohnung oder ein einzelnes Zimmer an eine dritte Person weitervermietet. Besonders in Wohngemeinschaften ist dies üblich, muss aber in der Regel vom Vermieter genehmigt werden.
Eine Ausnahme gilt für enge Familienangehörige, Ehepartner oder eingetragene Lebenspartner. Sie gelten nicht als Untermieter im Sinne des Gesetzes. In diesen Fällen genügt eine schriftliche Mitteilung an den Vermieter – eine Genehmigung ist nicht erforderlich.
Mieter haben grundsätzlich einen Anspruch auf Erteilung der Erlaubnis zur Untervermietung, wenn nach Abschluss des Mietvertrages ein berechtigtes Interesse entsteht (§ 540 BGB). Ein solches Interesse kann vorliegen, wenn der Mieter:
Gerichte erkennen diese Gründe regelmäßig als ausreichend an, sofern keine wichtigen Einwände gegen den Untermieter bestehen.
Der Vermieter darf die Untervermietung nur verweigern, wenn wichtige Gründe vorliegen, z. B.:
Fehlen solche Gründe, muss der Vermieter zustimmen. Eine formlose Genehmigung ist möglich, aus Beweisgründen empfiehlt sich jedoch eine schriftliche Bestätigung.
Vermietet ein Mieter Wohnraum ohne Genehmigung, riskiert er eine fristlose Kündigung. Der Vermieter muss jedoch zuvor abmahnen und Gelegenheit geben, die Untervermietung zu beenden.
Wichtig: Hätte der Vermieter die Untervermietung genehmigen müssen, ist eine fristlose Kündigung unwirksam. In diesem Fall kann der Mieter weiterhin im Mietverhältnis bleiben.
Der Vermieter darf seine Zustimmung zur Untervermietung nur dann von einer angemessenen Mieterhöhung abhängig machen, wenn ihm durch den zusätzlichen Bewohner nachweislich höhere Kosten entstehen – etwa bei einer Inklusivmiete mit gestiegenen Nebenkosten.
In den meisten Fällen trägt der Mieter jedoch selbst die Nebenkosten, sodass dem Vermieter keine Mehrbelastung entsteht. Eine Zustimmung gegen Aufpreis ist daher meist nicht zulässig.
Sobald ein berechtigtes Interesse besteht, etwa bei finanziellen Schwierigkeiten oder wenn der Partner einzieht. Der Vermieter muss dann in der Regel zustimmen.
Nur aus wichtigem Grund, z. B. bei Überbelegung oder unzumutbaren Umständen. Ohne triftigen Grund ist eine Ablehnung nicht rechtens.
Der Vermieter kann abmahnen und im schlimmsten Fall fristlos kündigen. War die Erlaubnis jedoch eigentlich zu erteilen, bleibt die Kündigung unwirksam.